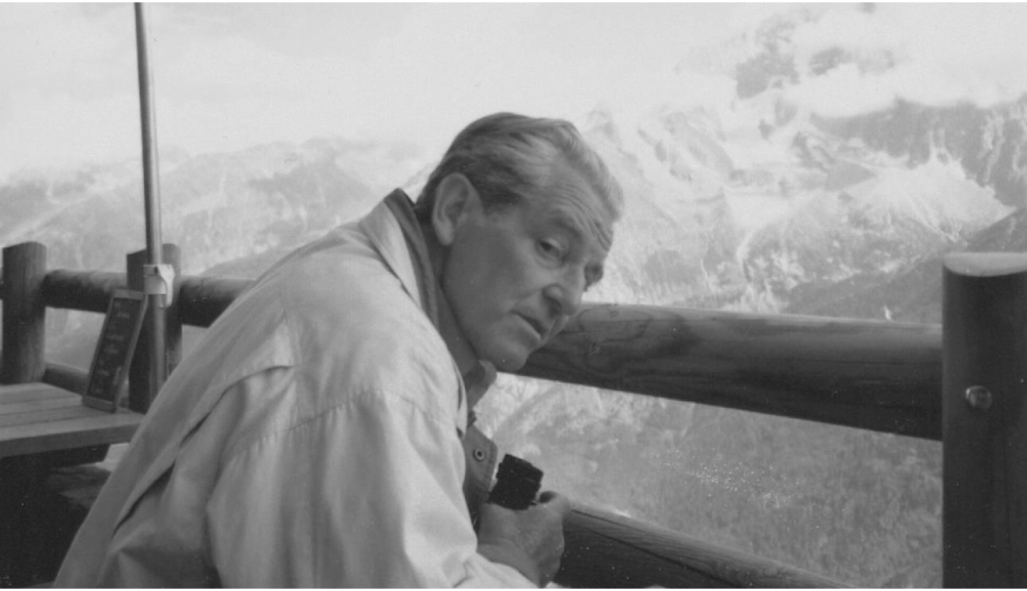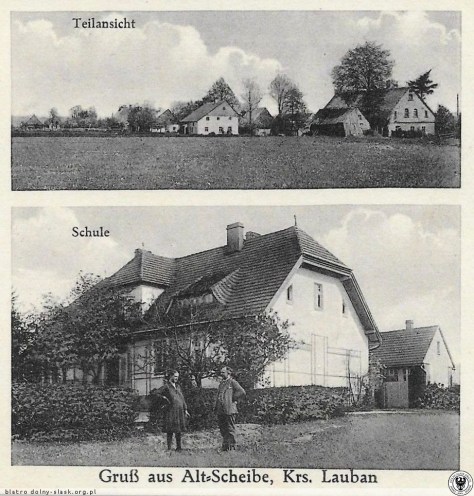Zeit der Neufindung
Am 1. Oktober 1945 begann der Schulunterricht wieder. Das große Gebäude der Eosander-Schule hatte die Wehrmacht zwischenzeitlich als Reserve-Lazarett genutzt. Schüler und Lehrer fanden ein Chaos vor, das es galt aufzuräumen. Die Bücher der Schüler- und Lehrerbibliothek lagen in einem verdreckten Haufen auf dem Dachboden. Walter Beck nutzte seine Bibliothekserfahrung, die er in Zakopane gewonnen hatte, übernahm die Rekonstruktion der beiden Bibliotheken und die Ausleihe. „Habent sua fata libelli“ – Bücher haben ihre Schicksale – kalligraphierte er mit Ausziehtusche auf ein schönes Blatt Papier, das er an den Tisch heftete, über den die Bücher gingen. In seinem Abiturzeugnis wurde ihm später bescheinigt: „Herr Beck hat sich um den Wiederaufbau der Schüler- und Lehrerbücherei sehr verdient gemacht.“
Nie wieder Krieg, Aufbau einer Gesellschaft, die auf Humanismus und Frieden beruht. Das war der Grundgedanke, der fortan für das Land bestimmend sein sollte. Das bedeutete eine radikale Abkehr vom Vergangenen, die für Walter Beck und die meisten seiner Generation nicht so einfach zu vollziehen war: „In unseren Köpfen spukte noch vieles, was der faschistischen Zeit entstammt, unserer zuvor erfahrenen Erziehung durch die nationalsozialistisch ausgerichtete Schule. Wir mussten uns mit allem auseinandersetzen, was wir zuvor aufgenommen hatten“, schilderte er die Situation, in der er und seine Mitschüler sich damals befanden. All das musste verarbeitet werden. Vieles davon als Lüge zu begreifen, auszusondern, zu überwinden, aus einem Irrweg herauszufinden und gangbare Wege zu erkennen, war ein fortwährendes Vergleichen, eine Konfrontation ihrer vorhandenen Überzeugungen mit dem Neuen. War ein stetiges Abwägen: Was ist richtig? Was ist für uns richtig?
Die „Eosander“-Schüler hatten das große Glück, von Lehrern unterrichtet zu werden, die um dieses Dilemma wussten. Sie besaßen, wie Walter Beck im Nachhinein konstatierte, die nötige Geduld und Persönlichkeit, mit den 16- bis 18jährigen über ihre Fragen und Zweifel zu diskutieren. „Wir hatten ein großes Misstrauen, gegenüber allem Neuen, auch Lehrern gegenüber, denen wir vertrauten. Wir wollten uns nicht wieder in die Irre führen lassen. Man hatte uns gelehrt, Krieg sei ein edles Handwerk, ein patriotisches Recht, gar eine naturgegebene Notwendigkeit. Erlebt haben wir ihn als grausame Tatsache.“
Viele von Walter Becks Mitschülern hatte man als Soldaten, als Flakhelfer und Schanzarbeiter in den letzten Kriegswochen, als die Niederlage schon absehbar war, in den Kampf geschickt. Manche kehrten nicht zurück. Keiner der Jungen wollte künftig wieder ein Gewehr anfassen. Der Leitsatz: „Nie wieder Krieg!“ leuchtete ihnen ein. Aber die Urteile des Nürnberger Prozessen anzunehmen, taten sich die Schüler schwer. Zu tief noch saß das Gelernte. „Das Land hat einen Krieg geführt und ihn verloren. Unrecht, finden wir damals, sei er wohl nicht. Die Führer des Landes zu liquidieren, erleben wir als Rache der Sieger. Das erschien uns unfair, gleichsam nicht ritterlich“, gab Walter Beck den Zwiespalt wieder, der sich für ihn und seine Klassenkameraden damals auftat. Es bedurfte eines langen Nachdenkens und vielfachen Erklärens, ehe sie von ihrer Vorstellung abkamen, Krieg sei ein „edles Turnier, bei dem Regeln eingehalten werden müssen, und nach dessen Abschluss man sich gegenseitig Respekt erweist.
In der Literatur fand er bei Erich-Maria Remarque, Henri Barbusse und vor allem bei Johann Gottfried Herder die andere Seite des Krieges beschrieben, sein unheilvolles, todbringendes Wesen. „Das hatten unsere früheren Lehrer verschwiegen vor uns. Keiner hat den Krieg in seiner Totalität oder gar grundsätzlich in Zweifel gezogen. Stattdessen wurde uns Hölderlins törichter Satz vielmals vorgewiesen, wonach es süß sei und ehrenvoll, fürs Vaterland zu sterben.“ Die Entdeckung Johann Gottfried Herders war für den inzwischen fast 18jährigen sein Heureka. Er las begierig alles, was er von ihm finden konnte. Die Nachkriegsausgabe seiner „Briefe zur Beförderung der Humanität“, vom Greifenverlag Rudolstadt 1947 unter der Lizenz-Nummer 116 der sowjetischen Militärverwaltung herausgegeben, war für ihn eins der wichtigsten Bücher. Es erinnerte ihn sein Leben lang, wie er damals Ordnung in sein Weltbild zu bekommen suchte.
Bücher gehörten bald zum Unerlässlichen im Leben des Schülers. Sein Deutschlehrer Dr. Karl, ein älterer Pädagoge, hatte sich über den Ungeist der Nazijahre hinweg das progressive, bürgerliche Verständnis von Literatur bewahrt. Es gelang ihm, seinen Schülern eine Vorstellung von der Größe der deutschen Literatur zu vermitteln, ihnen ein Grundgefühl von Humanismus zu geben. Er regte sie an, sich Autoren wie Stefan Zweig und die Philosophin Ricarda Huch zuzuwenden, die ihren Blick auf die Welt, die Menschheitsgeschichte lenken. „Ich machte mir die wesentliche Veränderung der Bewertung des Krieges zu eigen. Sie wurde mir zu einem festen Bestandteil der Vorstellungen von einem menschenwürdigen Zusammenleben“, reflektierte der 94jährige Walter Beck in unserem Gespräch. Die Gegenwart, in der deutsche Politiker wieder Kriegsbereitschaft einfordern, machte ihm Sorge. „Mit meiner Zustimmung können sie nicht rechnen“, sagte er.
Der Krieg nahm ihm den Vater, an dem er seine Zukunft orientiert hatte. Dem 16jährigen fehlte nun der Antrieb, sich auf sein ursprüngliches Berufsziel zu fokussieren. Seine Interessen veränderten sich zu seiner eigenen Überraschung radikal. Was sein Deutschlehrer angeschoben hatte, offen zu sein für neue Sichten, nahm seinen Lauf.

Die sowjetische Militärverwaltung sah als eins ihrer wichtigsten Anliegen, das kulturelle Leben in Berlin wieder aufzubauen. Bereits am 28. April erteilte der sowjetische Stadtkommandant Nikolai Bersarin die Erlaubnis zur Wiedereröffnung von Theatern und Lichtspielstätten. Zugleich wurden Synchronstudios gefördert, um sowjetische Filme in deutscher Sprache zeigen zu können. Im Nachkriegsberlin 1946/47 sah Walter Beck voll Staunen seine ersten sowjetischen Filme: „Die schöne Wassilissa“ von Alexander Rou, der noch sehr jung schon Maßstäbe für den sowjetischen Märchenfilm setzte, „Der neue Gulliver“ und das Märchen „Die steinerne Blume“ von Alexander Ptuschko, Einsam blinkt ein Segel“ von Wladimir Legoschin, „Erziehung der Gefühle“ von Mark Donskoi. Der 17jährige Oberschüler wusste damals noch nichts über das Filmemachen, bemerkte aber den Unterschied zu jenen Filmen, die er kannte, und registrierte, dass die sowjetischen Filmemacher mit einer ganz anderen Haltung herangingen. Das schaffte ihm große Erlebnisse.

Gleichzeitig ging man in der SBZ daran, eine neue deutsche Filmindustrie im ins Leben zu rufen, die sich mit ihren Produktionen dem Antifaschismus und Humanismus verpflichtet fühlt. Kameramann Werner Krien, Regisseur Kurt Maetzig, die Schauspieler Hans Klering, Produktionsleiter Adolf Fischer, die Filmszenenbildner Carl Haacker und Willy Schiller sowie der Elektroingenieur und Beleuchter Alfred Lindemann bildeten im August 1945 das Filmaktiv, den Vorläufer der DEFA. Am 19. Februar 1946 kam als neue Wochenschau „Der Augenzeuge“ erstmals in die Kinos. Am 17. Mai wurde auf dem Gelände der Althoff-Ateliers Potsdam-Babelsberg die „Deutsche Film AG “ (DEFA) gegründet. Dieser Tag gilt als Geburt des neuen deutschen Films. Und er „ist auch der Geburtstag des neuen deutschen Kinderfilms, oder besser: des DEFA-Spielfilms für Kinder, der sich zu einer neuen, besonders ausgeprägten Art von Kinderfilm entwickeln wird, der ich den größten Teil meiner Berufsarbeit widmen werde“, schreibt Walter Beck aus der Perspektive seines gelebten Lebens.

Damals jedoch hatte die Gründung der DEFA für Walter Beck nur insofern Bedeutung, als dass die DEFA-Filme ihm seine Lebenswelt mit einer nicht gekannten Realitätsbezogenheit vor Augen führten. Sie konfrontierten ihre Zuschauer mit Wahrheiten, auf die sie nicht gefasst waren. Wie Wolfgang Staudtes „Die Mörder sind unter uns“, der am 15. Oktober 1946 im Berliner Admiralspalast Premiere hatte. Der Film behandelt ein Thema, dessen damalige Aktualität noch heute Gültigkeit besitzt. Ein untergetauchter Kriegsverbrecher führt nach Kriegsende 1945 mitten in der Gesellschaft ein bürgerliches Leben mit Frau und Kindern. Hauptmann a. D. Brückner produziert aus Stahlhelmen Kochtöpfe, ohne Skrupel zu haben, dass er drei Jahre zuvor in Polen 121 Zivilisten erschießen ließ. Er hält sich für unschuldig. Als ihn sein ehemaliger Stabsarzt Mertens, der als Mitwisser darunter leidet, erschießen will, kommt sein Verbrechen ans Licht. Tief bewegt von diesem Erlebnis ging der 17jährige nach Hause.

Walter Beck sah jeden neuen DEFA-Film, sobald er ins Kino kam. Einer, so empfand er es, ging ihn ganz persönlich etwas an, Gerhard Lamprechts Film „Irgendwo in Berlin“. In den erzählten Schicksalen von Gustav, seinem Freund Willi und den anderen Kindern spiegelt sich sein eigenes Erleben in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Wie er haben sie bislang nur den Krieg erlebt. Niemand von den Erwachsenen, die noch unter dem Trauma Faschismus und Krieg leiden, bemerkt ihre seelischen Bedrängnisse. Willi weiß nicht, ob seine Eltern noch leben, und hilft einem Schwarzhändler, um Lebensmittel zu bekommen. Gustav glaubt unerschütterlich an die Heimkehr seines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft. Ganz so, wie es der damals 14jährige Walter Beck hoffte. Im Film kommt der Vater nach Hause, entkräftet, zu mutlos, um neu anzufangen. Der tödliche Unfall von Willi, der von einer Brandmauer stürzt, reißt Gustavs Vater aus seiner Lethargie. Die Kinder beenden ihre Kriegsspiele. Zusammen räumen sie Trümmer beiseite und beginnen mit dem Aufbau der zerstörten Großgarage von Gustavs Vater.
Kein Film zuvor hat das Leben des 17-Jährigen jemals so berührt. „Ich weiß, als ich aus dem Kino gehe, zwar um meinen großen unmittelbaren Eindruck“, hebt er in seinem Kaleidoskop hervor, „aber keineswegs um die weitreichenden Folgen der Wirkung des Erlebten. Gleichwohl prägen sich seine Bilder tief in mein Gedächtnis ein.“ Er setzte Emotionen und Gedanken in Bewegung, die der Heranwachsende verinnerlichte und abspeicherte. Sie gehörten nun zu seinem emotionalen Fundus und waren von großer Wichtigkeit für seine Selbstfindung, wie er erzählte. „Das ist nicht leicht, zu keiner Zeit“, nahm er den Gedanken auf. „Aber damals war es für mich und meine Altersgenossen, die ihre Kindheit hindurch unter der Einwirkung der faschistischen Ideale standen, ganz besonders schwierig, die völlig neue Qualität der Lebensorientierung zu erkennen oder zumindest zu erahnen, die uns nahegelegt wurde.“ Er nahm den „erzieherischen Impuls“ auf, der sich ihm offenbarte. Gerhard Lamprechts Film wird später als der erste in einer langen Reihe von DEFA-Spielfilmen für Kinder gelten. Und der Kinderfilmregisseur Walter Beck wird bei seinen Filmen stets im Auge behalten, den jungen Zuschauern Impulse für ihre eigene Lebensorientierung zu geben.

Nach und nach öffneten in Berlin die Theater wieder. Sie übten eine fast ebenso große Anziehung auf den Oberschüler aus wie das Kino. Er geht in Opern, Operetten, Ballette. Doch am meisten interessierte ihn das Schauspiel. Im Theater am Schiffbauer Damm sah sich Friedrich Wolfs „Die Matrosen von Cattaro“ an, inszeniert von Ernst Busch. Sehr oft besuchte er Inszenierungen des Deutschen Theaters. „Ein grundlegendes Erlebnis“ wurde ihm die Aufführung von Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ im Deutschen Theater mit Paul Wegener in der Titelrolle: „Nachdem mir Krieg suspekt geworden ist, gerät nun die Ausgrenzung von bestimmten Menschengruppen zum Verwerflichen. Gerade noch habe ich ihn als Loucadou in»Kolberg« (1945 – Regie: Veit Harlan) gesehen, worin mir der totale Krieg als selbstverständliche Pflicht eines jeden dargestellt wird. Und jetzt sehe ich diesen beeindruckenden Schauspieler lebendig auf der Bühne, und er agiert in einem Stück, das mir das tolerante Zusammenleben nahelegt. Wie ein Schwamm sauge ich die Substanz dieses Stückes auf.“
Diese Gedanken hervorzuheben, die seine Wertvorstellungen und seine Moral entscheidend mitgeprägt haben, war ihm wichtig. Unerträglich empfand er, dass man das Erbe der deutschen Geschichte ignorierte und statt friedlicher Koexistenz eine Politik der Militarisierung betrieb. Offenbar habe man vergessen, wohin das schon einmal geführt hat. „Gewusst! Und aufs Neue vergessen!“, schloss Walter Beck.
Das Theater wirkte auf den Jugendlichen wie ein Sog. „Ich atme nahezu alles fast gierig ein. Und alles ist für mich neu – und vieles auch tief beeindruckend. Bei solcher Fülle künstlerischer Erlebnisse öffnet sich eine mir bis dahin nahezu unbekannte Welt“, erinnert er sich seinem autobiografischen Kaleidoskop an die Zeit. Eine „Überdosis Welttheater” überkam den Jungen. Es war, als wäre er in „neue Räume des Denkens und Fühlens getreten“. Die Wirkung blieb nicht aus. Der 17jährige will selbst Schauspieler werden. Ein Bedürfnis, das er zunächst in Laienspielgruppen stillte. Zu den Mitspielern gehörte der Sohn des Schauspielers Axel Triebel, mir aus vielen DEFA-Filmen bekannt. Von ihm hörten die Jungs, dass das Deutsche Theater Kleindarsteller suche. Walter Beck meldete sich und hatte in Wolfgang Langhoffs Inszenierung „Ein jeder von uns“ zusammen mit 30 anderen Kleindarstellern einen kurzen Auftritt als KZ-Häftling. Hinter einem Gazevorhang stehend, stellten sie die Traumvision dar, von der der Protagonist bedrängt wird. Von da an hatte ihn das Theaterspielen gefangen. Das war im März 1947. In fast 300 Vorstellungen stand er mit namhaften Schauspielern wie Eduard von Winterstein, Horst Drinda, Gustaf Gründgens, Antje Weisgerber oder Herwart Grosse auf der Bühne, erlebte sie bei den Proben und schnappte alles auf. Er war in Gerhart Hauptmanns „Agamemnons Tod“, in Sophokles‘ „König Ödipus“, Molières „Tartuffe“, Shakespeares „Romeo und Julia“, Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick“ und Lessings „Nathan der Weise“ in kleinen Auftritten dabei.
Es war ihm ernst mit seinem Wunsch, Schauspieler zu werden. Er bewarb sich für eine Aufnahme an der Schauspielschule des Deutschen Theaters und auf eine Zeitungsannonce hin, die seine Mutter ausgeschnitten hatte, zudem für einen Platz in der kurz zuvor, am 1. Februar 1948, gegründeten Schauspielschule des DEFA-Nachwuchsstudios. Für das Vorsprechen lernte er Egmonts Schluss-Monolog „Verschwunden ist der Kranz!“, einen Text von Sosias aus Kleists Verwechselungkomödie „Amphitryon“ sowie den Schlussmonolog des Korrespondenten Smith aus Simonows Schauspiel „Die russische Frage“. Er glaubte sich gut vorbereitet. Doch die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule des Deutschen Theaters fiel nicht zu seinen Gunsten aus. Der einzige Prüfer, ein Herr J. Wilhelm Hamacher, hatte von dem Neunzehnjährigen wohl eine, seiner Meinung nach, dem Alter entsprechende „vordergründige Rage und einen jünglingshaften Gefühlsüberschwang“ in der Vorführung erwartet. Das kam nicht. Woraufhin er dem Anwärter unverhohlen und nachdrücklich davon abriet, den Schauspielerberuf anzustreben.
Schon in seinem jungen Wesen besaß Walter Beck eine große Ensthaftigkeit und hatte eine ebensolche Auffassung von der Arbeit des Schauspielers. Seine Maßstäbe waren Inszenierungen wie Wolfgang Langhoffs „Furcht und Elend des Dritten Reiches“, deren Uraufführung er im Januar 1948 am Deutschen Theater erlebt hatte. „Monologische Verzückung und entflammte Formverliebtheit ist meine Sache nicht“, schreibt er. „Meine Aufmerksamkeit galt mehr dem, was die Sprache auszudrücken oder zu verschweigen sucht.“ Nur aus Korrektheit fand er sich einen Tag später, am 24. März, zur Aufnahmeprüfung im DEFA-Nachwuchsstudio ein. Ohne Begabung, wie ihm von einem Fachmann beschieden worden war, räumte er sich keine Chance ein. In gleicher Art und Weise trug er der Prüfungskommission seine Texte vor. In dem kleinen Raum saßen um die zwanzig der wichtigsten DEFA-Leute, Regisseure und Drehbuchautoren wie Kurt Maetzig, Wolfgang Staudte, Gerhard Lamprecht, der Wiener Georg C. Klaren, der sowjetische Filmautor und Regisseur Ilja Trauberg, der Schriftsteller Fritz Erpenbeck und der Schauspieler Hans Klering. Nach seinem Vortrag bedankte man sich und entließ ihn kommentarlos mit den alles und nichtssagenden Worten: „Sie hören von uns“.

Doch er hörte nichts. Das Abitur stand bevor. Es beunruhigte ihn, nicht zu wissen: Nimmt man mich oder nimmt man mich nicht. Um sich auf die Prüfungen konzentrieren zu können, brauchte er Klarheit. Als er im Sekretariat der Schule nachfragte, geriet die Sekretärin in Aufregung. Wie sich herausstellte, war es ihr im Trubel der Neueröffnung der Schule untergegangen, ihn zu benachrichtigen. Ilja Trauberg, im DEFA-Vorstand zuständig für den Nachwuchs, hatte ihm eine persönliche Mitteilung hinterlassen. Er bat den 19jährigen ausdrücklich, erst sein Abitur zu machen, und im kommenden Januar ein Studium in der neuen Regieklasse aufzunehmen. „Ich erlebe den Vorgang als einen Erfolg, wie ich ihn nicht zu träumen gewagt hätte“, kommentiert Walter Beck in seinen Erinnerungen.
Ende der Ungewissheit
Es machte für ihn damals keinen Unterschied, ob er Schauspieler oder Regisseur sein würde. Er hatte so einige Schauspieler erlebt, die Regie führen – beispielsweise Gustaf Gründgens und Wolfgang Langhoff. So war er geneigt, in Regisseuren so eine Art Ober-Schauspieler zu sehen. Traubergs Angebot stellte somit durchaus eine Erfüllung seines neuen Berufswunsches dar. Vor allem aber wusste er nun endlich, wie sein Leben nach dem Abitur weitergeht. Die Unsicherheit, ob es richtig ist, seinen ursprünglichen Lebensplan aufzugeben, nicht in die Fußstapfen des Vaters zu treten, sondern dem neuen, drängenden Berufswunsch nachzugeben, war vorbei. Aus dieser Sicherheit, die ihm das Angebot von Ilja Trauberg gab, erwuchs ihm Zuversicht und Selbstvertrauen. Er hätte von ihm gern erfahren, was ihn zu der Entscheidung bewogen hatte. Walter Beck ist dem Filmregisseur jedoch nie mehr begegnet. Trauberg ist am 8. Dezember 1948 mit nur 43 Jahren an einem Herzschlag verstorben.
Im Juli 1948 hatte Walter Beck sein Abitur-Zeugnis in der Hand. Er nennt es einen merkwürdigen Meilenstein seines Lebens. Man strebt darauf zu, reift zwölf Schuljahre heran, dann hat man endlich seine Reife-Bescheinigung, und der Fall ist erledigt, sinnierte er ein erfülltes Leben später. Bedeutsam war für ihn nur der Satz: „Herr Beck will Regisseur werden.“ Ein knappes halbes Jahr verblieb ihm bis zum Studienbeginn im Januar 1949. Vier Wochen machte er mit seinem Faltboot Ferien im Spreewald, wo er jedes Fließ kannte. Dann überlegte er, die übrigen fünf Monate zu nutzen und sein künftiges Betätigungsfeld ein bisschen kennenzulernen. Das DEFA-Nachwuchsstudio fand für ihn eine Stelle als Regie-Assistent, die im Grunde nichts mit der wirklichen Arbeit eines Regie-Assistenten im Atelier zu tun hatte. Er war „Mädchen für alles“, machte, was anfiel. Neben der Arbeit, die ihm fiel freie Zeit ließ, hospitierte er in der Schauspielklasse. Vieles, was er hier lernte, traf ebenso auf Regisseure zu. Nicht Selbstverwirklichung ist Aufgabe der einen wie der anderen. Die Handlung eines Films, die Geschichte soll so transportiert werden, dass der Zuschauer die Fähigkeit gewinnt, die Welt veränderbar zu sehen. Dass er selbst geneigt ist, sich zu verändern. Dieses Grundanliegen durchzog Walter Becks gesamtes Arbeitsleben.
Gleich nach Neujahr 1949 begann für Walter Beck das zweijährige Studium in der ersten Regieklasse des DEFA-Nachwuchsstudios. Seinen Werdegang Jahrzehnte später betrachtend, würdigte er sie als „ausgezeichnet, als das Beste, was damals auf diesem Gebiet geboten werden konnte“.

Viele Dozenten kamen aus der Filmpraxis wie die Regisseure Dr. Kurt Maetzig („Ehe im Schatten“, 1947) und Wolfgang Schleif („Die blauen Schwerter“, 1949) sowie der DEFA-Chefdramaturg und Filmautor Dr. Wolff von Gordon („Das kalte Herz“, 1950). Filmtechnik lehrte Dr. Etzold vom Institut für Schwingungsforschung der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg. Kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge vermittelten die Schriftsteller Wolfgang Weyrauch und Wolfgang Joho sowie Professor Wolfgang Heise, einer der bedeutendsten Philosophiehistoriker der DDR. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, die Ausbildung des Regienachwuchses der DEFA hatte Hochschulniveau.

Das Handwerkliche blieb jedoch nicht außen vor. Einer, der das als unabdingbares Fundament für die Arbeit der angehenden Regisseure in den Mittelpunkt seines Lehrens stellte, war Wolfgang Schleif. „Was immer später mir an Aufgaben als Regie-Assistent begegnet“, schreibt Walter Beck, „Schleif hat uns dazu Wesentliches gesagt.“ Bei Wolff von Gordon erlernten die Regiestudenten das Drehbuchschreiben. Einen ersten Eindruck, wie die Arbeit mit Schauspielern ist, bekamen sie schon im Sommer 1949. Gemeinsam mit Schauspiel-Studenten inszenierten sie im Park von Sanssouci Goethes Schäferspiel „Die Laune der Verliebten“. Kurt Maetzig bezog sie hin und wieder als „Kleindarsteller mit Spiel“ in seine Filmarbeit mit ein. Er war uns großzügig zugetan, hatte Walter Beck in Erinnerung.

Als Maetzig 1949 für seinen Film „Die Buntkarierten“ den Nationalpreis erhielt, lud er alle Studenten des Nachwuchsstudios für eine Woche zu einem Skiurlaub nach Friedrichroda ein. „Man redete uns nicht ein, wir seien künftig unbedingt Regisseure. Wir begriffen uns als künftige Regie-Assistenten, denen selbstständige Arbeit ein darüber hinaus erst noch zu gewinnendes Ziel ist.“
Im Verlauf des Jahres 1949 traten die gesellschaftlichen Widersprüche zwischen West und Ost zunehmend deutlicher zutage. Der 19jährige Regiestudent erlebte dies als „Mannheimer, der in Pankow wohnt“. Was sich ihm damals noch nicht in vollem Umfang erschloss, vermerkt er Jahrzehnte später in seinen Erinnerungen. „Die Spaltung des Währungsgebietes Berlin führt zu einem Anwachsen des Antikommunismus.“ Westliche Journalisten und Politiker sprachen von der „Frontstadt Westberlin“, von der „Falltür in den Osten“, von der „billigsten Atombombe“. Die Menschen spüren die Gefahr, die über allem liegt. Die Angst vor einem dritten Weltkrieg ist groß, auch bei dem jungen Regiestudenten Walter Beck. Für ihn ist damals – und fürderhin – Bertolt Brechts dichterische Mahnung ein Gebot der Stunde, das er in jener Zeit, wo auch immer es sich anbot, rezitierte:
„Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten,
Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen!
Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen,
Als ob die alten nicht gelanget hätten.“
In diese Zeit fällt die für ihn „bedeutendste Theateraufführung“, die er „je erleben durfte“. Am 11. Februar 1949 sahen die Regiestudenten im Deutschen Theater Brechts Antikriegsdrama „Mutter Courage und ihre Kinder“ in der Regie von Erich Engel und Brecht selbst mit Helene Weigel als Courage. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636 und erzählt, wie die Marketenderin Mutter Courage versucht, ihr Geschäft mit dem Krieg zu machen und dabei ihre Kinder verliert. Man mag sie, steht ihr aber auch kritisch gegenüber, analysierte Walter Beck im Nachhinein sein Empfinden. Er ist damals fest überzeugt, dass diese Aufführung, die ein entschiedenes Plädoyer gegen den Krieg und den Irrglauben, das einfache Volk könnte daraus irgendeinen Nutzen ziehen, ein herausragender Markierungspunkt deutscher Theatergeschichte ist. Brechts Theorien eröffneten ihm lebensüberspannend „eine neue Sichtweise auf die Wirkungsabsichten künstlerischer Arbeit. Was ich in den Jahren danach auf der Bühne vom Regisseur Brecht sehe, beeindruckt mich nicht weniger. Seine Inszenierungen, von denen ich einige mehrfach sehe, gehören zum Bedeutenden, das ich in meinem Erlebnisfundus bewahre.“
Ein knappes Jahrzehnt später widerfuhr ihm das Glück, „Mutter Courage und ihre Kinder“ selbst inszenieren zu dürfen. 1958 vertraute ihm der Intendant des Staatstheaters Schwerin, schon damals eine der repräsentativsten Bühnen der DDR, die Regie für das Stück an. Eine Herausforderung, deren Ergebnis er nicht absehen konnte. Es war seine erste Inszenierung an einem richtigen Theater, beschränkten sich seine Bühnenerfahrungen bis dahin doch auf das Laienspiel. Aber ihm stand ein wunderbares Ensemble zur Seite, das ihn unterstützte. Da waren die namhaften Schauspieler Karin Seybert als Courage, die junge Carla Verlerius als stumme Kattrin. Eberhard Mellies, im gleichen Alter wie der Regisseur, spielte Eilif, den Lieblingssohn der Courage, kühn und mordlustig, ohne Skrupel. Wolfgang Sasse ist der lebensfrohe Koch, Herbert Sievers der humorvolle Prediger und Intendant Edgar Bennert der Obrist. Szenenbildner und Ausstattungsleiter Kurt Froese verstand es, das Bühnenbild nicht als Kopie des Brechtschen Modells erscheinen zu lassen, trug so mit dazu bei, dass es eine Beck-Inszenierung wurde. Die Vorstellung verfolgte Walter Beck vom Schnürboden aus. Er wagte es nicht, sich in den Zuschauerraum zu setzen, zu groß war seine Erregung. Der Applaus, der zu ihm hochdrang, löste seine Spannung.
Als Regisseur erlebte Walter Beck noch viele glückliche Premieren, doch war ihm diese in seinem langen Arbeitsleben als eine herausragende lebendig. Die Zusammenarbeit, die Dankbarkeit der Darsteller und die allseits lobende Resonanz waren etwas unvergesslich Großes. Seine Liebe zum Theater fand dort einen Höhepunkt und bleibende innige Verknüpfung. So sehr er die Arbeit für den Film liebte, das Theater war seine Jugendliebe, zu der er immer wieder zurückkehrte, so sich die Gelegenheit ergab.
Teil 3: Freud und Leid eines Regieassistenten